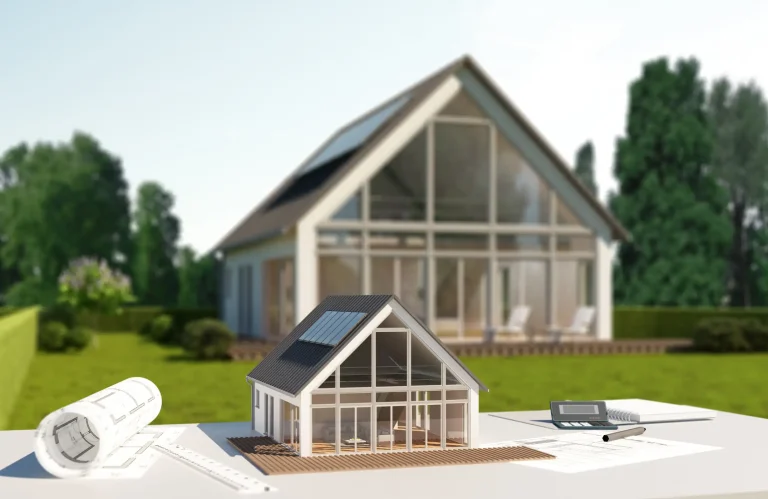Die Grundlage für eine wirtschaftlich arbeitende Solarthermieanlage ist eine präzise berechnete Dimensionierung in Kombination mit einer durchdachten Auslegung. Zahlreiche technische, klimatische und gebäudebezogene Faktoren spielen dabei eine entscheidende Rolle. Nur wenn all diese Aspekte berücksichtigt werden, lässt sich das Potenzial der Sonnenenergie effektiv für die Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung nutzen. So wird sichergestellt, dass die Investition dauerhaft sinnvoll und effizient bleibt.
- Wie funktioniert eine Solarthermieanlage?
- Was unterscheidet Solarthermie von Photovoltaikanlage?
- Welche Komponenten gehören zur Anlage?
- Welche Ziele hat die Berechnung einer Solarthermieanlage?
- Warum ist die richtige Dimensionierung einer Solarthermieanlage entscheidend?
- Wie berechnet man die benötigte Kollektorfläche?
- Welche Faustformeln gibt es für die Solarthermieberechnung?
- Wie groß muss der Solarspeicher sein?
- Was ist der solare Deckungsgrad?
- Was ist ein realistischer Deckungsgrad für Deutschland bei Warmwasser/Heizung?
- Welche Tools oder Software gibt es zur Berechnung von Solarthermie?
- Wann sollte ich einen Energieberater hinzuziehen?
- Welche Normen und Richtlinien gelten bei der Auslegung?
- Welche Planungsfehler treten in der Praxis häufig auf?
- Checkliste: Diese Angaben brauchen Sie für eine sinnvolle Berechnung
- Diese 5 Dinge sollten Sie beachten
- Fazit
- Solaranlage berechnen: Häufig gestellte Fragen
Alles auf einen Blick:
- Solarthermie nutzt Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung und kann für Warmwasseraufbereitung und Heizungsunterstützung genutzt werden.
- Die richtige Dimensionierung der Anlage richtet sich nach Eigenverbrauch, Standort, Dachausrichtung, Nutzungsprofil und gewünschtem Deckungsgrad.
- Zur Berechnung gilt die Faustregel, dass pro Person etwa ein bis eineinhalb Quadratmeter Kollektorfläche für die Warmwasserbereitung eingeplant werden sollten.
- Die Auslegung einer Solarthermieanlage ist technisch durch mehrere Normen geregelt. Diese sichern die Effizienz, die Betriebssicherheit und die Förderfähigkeit der Systeme. Wer Fördermittel beantragen möchte, muss bestimmte technische Standards einhalten.
- Planen Sie die Installation einer Solarthermieanlage, sollten Sie sich im Vorfeld ausführlich beraten und Ihren Bedarf am besten durch einen Profi berechnen lassen.
Wie funktioniert eine Solarthermieanlage?
Eine Solarthermieanlage wandelt Sonnenenergie in nutzbare Wärme um. Das Herzstück des Systems sind Sonnenkollektoren, die die einfallende Sonnenstrahlung aufnehmen. In ihnen befindet sich ein flüssiger Wärmeträger, der diese Wärme über ein geschlossenes Rohrsystem zu einem Wärmetauscher transportiert, das die thermische Energie an das Heiz- oder Trinkwasser abgibt. Der Prozess wird über eine intelligente Regelungseinheit gesteuert. Das gesamte System arbeitet dabei vollautomatisch: Ein Temperaturfühler misst, ob die Kollektoren wärmer sind als der Speicher. Sobald das der Fall ist, startet die Umwälzpumpe und beginnt mit dem Wärmetransport. Um Wärmeverluste während des Transports zu minimieren, werden die Leitungen zusätzlich gedämmt. Die gewonnene Energie lässt sich sofort nutzen oder bei ausreichender Speichergröße auch zeitlich versetzt einsetzen.
Was unterscheidet Solarthermie von Photovoltaikanlage?
Bei der Solarthermie wird die Sonnenstrahlung über Kollektoren direkt in thermische Energie umgewandelt, die dann für Warmwasser oder Raumheizung genutzt wird. Photovoltaikanlagen oder auch PV-Anlagen hingegen nutzen Solarmodule aus Halbleitermaterialien (meist Silizium), um Solarstrom zu erzeugen, der entweder direkt genutzt, gespeichert oder ins Stromnetz eingespeist wird. Ob Photovoltaikanlage oder Solarthermie: Beide Systeme können als Solaranlage bezeichnet werden.

Übersicht: Solarthermie & Photovoltaik im Vergleich
| Merkmal | Solarthermie | Photovoltaik |
|---|---|---|
| Energieform | Wärme | Strom |
| Nutzung im Gebäude |
|
|
| genutzte Module | Flachkollektoren oder Vakuumröhren | Solarmodule |
| Speichermöglichkeit | Wärmespeicher (z. B. Pufferspeicher) | Batteriespeicher (z. B. Lithium-Ionen) |
| Komplexität |
|
|
| Förderprogramme |
|
|
| Wartungsaufwand | höher (z. B. regelmäßige Kontrolle von Solarflüssigkeit und Pumpe) | gering (meist nur Wechselrichter und Reinigung) |
| Wirkungsgrad | hoch, bei direkter Wärmegewinnung (bis zu 70 %) | im Vergleich geringer, abhängig von Modulqualität und Sonneneinstrahlung (15 bis 25 %) |
| Platzbedarf | geringere Fläche bei hohem Wirkungsgrad | größerer Platzbedarf für vergleichbare Energieausbeute |
Welche Typen von Solarthermieanlagen gibt es?
Solarthermieanlagen unterscheiden sich unter anderem durch die Art der verwendeten Sonnenkollektoren. Besonders Flachkollektoren und Vakuumröhrenkollektoren haben sich auf dem Markt etabliert. Darüber hinaus existieren weitere Kollektorarten, wie zum Beispiel Hybridkollektoren, die sowohl Strom als auch Wärme erzeugen, oder sogenannte Luftkollektoren.
Flachkollektoren
Diese Kollektoren bestehen aus einer dunklen Absorberplatte, die in einem wärmegedämmten Gehäuse mit Glasabdeckung eingebettet ist. Das Sonnenlicht erwärmt den Absorber, und die entstehende Wärme wird über Rohre an das Solarfluid weitergegeben. Sie sind günstiger in der Anschaffung, mechanisch robust und gut geeignet für große, südlich ausgerichtete Dachflächen mit flacher Neigung.
Vakuumröhrenkollektoren
Wie die Bezeichnung bereits verrät, handelt es sich hierbei um mehrere nebeneinander angeordnete Glasröhren. In den Röhren befindet sich Vakuum. Dieses Vakuum wirkt wie eine Thermoskanne und verhindert Wärmeverluste nahezu vollständig. Im Inneren jeder Röhre ist zudem ein Absorberrohr mit Wärmerohr oder Direktdurchströmung verbaut, das die Sonnenwärme besonders effizient aufnimmt, selbst bei diffusem Licht, schrägem Einfallswinkel oder niedrigen Außentemperaturen.
Luftkollektoren
Luftkollektoren arbeiten im Gegensatz zu anderen Kollektoren nicht mit Flüssigkeit als Wärmeträger, sondern nutzen Luft. Sie gelten als besonders effizient, werden aber für den alltäglichen Gebrauch selten verbaut. In der Regel können Luftkollektoren jedoch eine wirkungsvolle Ergänzung zur Energieversorgung von Raumheizungen oder Belüftungssystemen sein.
Hybridkollektoren
Hybridkollektoren, auch als Photothermie-Kollektoren bezeichnet, kombinieren die Technologien von Photovoltaik und Solarthermie. Sie ermöglichen die gleichzeitige Nutzung von Sonnenenergie zur Stromerzeugung sowie zur Warmwasseraufbereitung oder Heizungsunterstützung. Diese Technik ist vergleichsweise neu und hat sich in der breiten Anwendung noch nicht durchgesetzt. Entsprechend sind auch die Kosten für die Anschaffung relativ hoch.

Welche Komponenten gehören zur Anlage?
- Kollektoren: in der Regel Flachkollektoren oder Vakuumröhrenkollektoren, je nach Einsatzgebiet
- Solarflüssigkeit (Solarfluid): ein frostsicheres Trägermedium zur Wärmeübertragung
- Rohrsystem mit Pumpe und Rückschlagventil: für den Transport des erwärmten Fluids
- Wärmetauscher: überträgt die Wärme auf das Brauch- oder Heizwasser
- Solarspeicher: je nach Anlagenart, wird hier ein Pufferspeicher, ein Trinkwasserspeicher oder ein Kombispeicher installiert
- Regelungseinheit: steuert Pumpen und misst Temperaturen zur Optimierung des Betriebs
- Sicherheits- und Entlüftungseinrichtungen: stellt einen reibungslosen und sicheren Betrieb sicher
Welche Ziele hat die Berechnung einer Solarthermieanlage?
- Reduktion von Heizkosten durch geringeren Energieeinsatz
- Maximierung des solaren Deckungsgrads, zum Beispiel 60 bis 70 Prozent bei Warmwasser
- Vermeidung von Stagnation und Energieverlust durch zu große oder falsch abgestimmte Komponenten
- Erfüllung technischer Nachweise für Förderanträge (z. B. BAFA, KfW)
Warum ist die richtige Dimensionierung einer Solarthermieanlage entscheidend?
Wenn Sie eine Solaranlage planen ist eine gute Dimensionierung ausschlaggebend für die Effizienz. Eine Solarthermie, die auf Ihren Gebrauch angepasst ist, reduziert langfristig den Wartungsaufwand, verlängert die Lebensdauer und sorgt für eine verlässliche Wärmequelle. Besonders bei Kombianlagen, also Systemen, die sowohl Warmwasser als auch Heizungswasser bereitstellen sowie bei komplexeren Gebäuden ist eine präzise Berechnung des Energiebedarfs besonders wichtig.
Was passiert bei Über- oder Unterdimensionierung?
Bei einer Unterdimensionierung Ihrer Anlage reicht die gewonnene Wärme nicht aus, um Ihren Bedarf zu decken. Das führt dazu, dass Sie zusätzlich konventionelle Heizsysteme einschalten müssen. Durch den niedrigeren Deckungsgrad wird die Wirtschaftlichkeit der Anlage deutlich gemindert. Im umgekehrten Fall, bei einer Überdimensionierung, entsteht mehr Wärme, als Sie speichern oder verbrauchen können. Dadurch gerät die Anlage häufiger in den Stillstand (Stagnation), was das Material beansprucht und den Wartungsaufwand erhöht. Auch hier zeigt sich, wie wichtig es ist, vorab korrekt zu rechnen. Eine zu große Anlage beansprucht unnötig viel Platz und verursacht hohe Investitionskosten, die sich wirtschaftlich oft nicht mehr amortisieren lassen.
Wie hängt die Effizienz mit der Auslegung zusammen?
Schon kleine Ungenauigkeiten führen schnell zu deutlichen Einbußen bei der Systemeffizienz. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn der Temperaturfühler nicht richtig positioniert ist oder die Hydraulik der Anlage nicht korrekt abgestimmt wurde. Auch eine durchdachte Platzierung der Kollektoren auf dem Dach ist notwendig, um einen hohen Ertrag zu gewinnen. Eine unpassende Dimensionierung des Speichers oder falsch eingestellte Regelparameter können ebenfalls dafür sorgen, dass die gewonnene Solarwärme nicht optimal genutzt wird.
Wie berechnet man die benötigte Kollektorfläche?
Die benötigte Kollektorfläche hängt davon ab, was Sie mit ihr erreichen wollen. In diese Überlegung fließt zunächst ein, ob sie nur der Gewinnung von Warmwasser dient oder auch zur Heizungsunterstützung. Planen Sie Ihre Solaranlage zusätzlich für die Heizungsunterstützung zu nutzen, dann fällt die benötigte Kollektorfläche höher aus. Deshalb sollten Sie mit realistischen Annahmen rechnen und nicht pauschal von Durchschnittswerten ausgehen. Je nach Standort und Ausrichtung des Dachs kann die benötigte Fläche kleiner oder größer ausfallen. Neben der geplanten Nutzungsart fließen jedoch auch weitere Faktoren in die Berechnung der benötigten Kollektorfläche ein.
Welche Faktoren fließen in die Berechnung der Solarthermieanlage ein?
- Anzahl der Personen im Haushalt
- Standort und solare Einstrahlung
- energetischer Gebäudezustand
- Dachneigung, Dachausrichtung und Verschattung
- Eigenverbrauch an Wärmeenergie
- Kollektorenart und deren Wirkungsgrad
- Speichergröße
- individueller, festgelegter Deckungsgrad
- Wohnfläche bei Heizungsunterstützung
Welche Faustformeln gibt es für die Solarthermieberechnung?
| Berechnung für | Faustformel |
|---|---|
| Warmwasser |
|
| Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung |
|
| Speichergröße für Warmwasser |
|
Diese Angaben gelten bei durchschnittlichem Eigenverbrauch, guter Dämmung und südlicher Dachausrichtung. Bei höheren Komfortansprüchen, oder schlechterer Ausrichtung, muss großzügiger kalkuliert werden. Neben einer manuellen Rechnung gibt es online auch einige Solarrechner, die Sie für eine erste Einschätzung nutzen können.
Richtwerte für die Solarthermie nach Haushaltsgröße
| Haushaltsgröße | Kollektorenfläche: Flachkollektoren | Kollektorenfläche: Röhrenkollektoren |
| 1 Person | 1 bis 1,5 Quadratmeter | 1 bis 1,25 Quadratmeter |
| 2 Personen | 2 bis 3 Quadratmeter | 2 bis 2,5 Quadratmeter |
| 3 bis 5 Personen | 3 bis 7,5 Quadratmeter | 3,75 bis 6,25 Quadratmeter |
| 6 bis 8 Personen | 6 bis 12 Quadratmeter | 6 bis 10 Quadratmeter |
Beispielrechnung: Solarthermie Einfamilienhaus mit 4 Personen
Um die Dimensionierung einer Solarthermieanlage realistisch abzuschätzen, betrachten wir einen durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalt in einem gut gedämmten Einfamilienhaus mit optimaler Südausrichtung und 120 Quadratmetern. Ziel ist die Warmwasserbereitung mit zusätzlicher Heizungsunterstützung.
1. Warmwasserbedarf
Für vier Personen ergeben sich durchschnittlich 110 bis 160 Liter Warmwasser pro Tag. Das entspricht einem jährlichen Energiebedarf von ungefähr 2.000 kWh (160 Liter × 365 Tage, unter Berücksichtigung des Warmwasser-Mischanteils). Die notwendige Kollektorfläche für eine zusätzliche Heizungsunterstützung rechnen Sie separat mit der Formel 1 Quadratmeter pro 10 Quadratmeter Wohnfläche aus, wodurch sich der Gesamtflächenbedarf entsprechend erhöht.
2. Berechnung Kollektorfläche
Flächenkollektoren
| Nutzung | Berechnung | Fläche |
|---|---|---|
| Warmwasser | 4 Personen × 1,5 Quadratmeter pro Person | 6 Quadratmeter |
| Heizungsunterstützung | 120 Quadratmeter Wohnfläche/10 | 12 Quadratmeter |
| Gesamtfläche | 6 Quadratmeter + 12 Quadratmeter | 18 Quadratmeter |
Röhrenkollektoren
| Nutzung | Berechnung | Fläche |
|---|---|---|
| Warmwasser | 4 Personen × 1,25 Quadratmeter pro Person | 5 Quadratmeter |
| Heizungsunterstützung | 4 Personen × 2 Quadratmeter pro Person | 8 Quadratmeter |
| Gesamtfläche | 5 Quadratmeter + 8 Quadratmeter | 13 Quadratmeter |
Wie groß muss der Solarspeicher sein?
Der Speicher ist das Bindeglied zwischen Erzeugung und Verbrauch, indem er Produktionsspitzen und Nutzungszeiten ausgleicht und Wärmeüberschüsse zwischenspeichert. Die Größe richtet sich dabei nicht nur nach der Nutzeranzahl, sondern vor allem nach der Kollektorfläche, dem Verwendungszweck und dem gewünschten Deckungsgrad.
Als Faustregel beim Solarspeicher gilt:
- pro Person (Warmwasseranlagen): 80 bis 100 Liter Speichervolumen
- pro Quadratmeter Kollektorenfläche (Kombianlage): 50 bis 80 Liter Speichervolumen
Wie Ihre Solaranlage sowie der Speicher dimensioniert werden müssen, damit Sie den optimalen Energieertrag erzielen, hängt von vielen unterschiedlichen Einflussfaktoren ab. Daher sollten Sie sich für eine genaue Berechnung am besten an einen Profi wenden und einen Termin für eine Solarberatung vereinbaren.
Was ist der solare Deckungsgrad?
Der solare Deckungsgrad beschreibt, welcher Energieanteil durch eine Solaranlage abgedeckt werden kann. Handelt es sich um eine Solarthermieanlage ist die Wärmeenergie gemeint. Der Grad gibt Auskunft darüber, wie es um die Effizienz und Wirtschaftlichkeit der Anlage steht. Je höher der Deckungsgrad, desto unabhängiger ist das System von externen Energiequellen.
Wie wird der solare Deckungsgrad berechnet?
Um den solare Deckungsgrad zu ermitteln, können Sie mit folgender Formel rechnen:
solarer Deckungsgrad in Prozent = (jährlich solar erzeugte Wärme in kWh/jährlicher Gesamtwärmebedarf des Gebäudes in kWh) × 100
Was bedeutet 60 Prozent Deckungsgrad?
Liegt der solare Deckungsgrad bei 60 Prozent, dann wird der jährliche Wärmebedarf zu diesem Anteil durch Solarenergie gedeckt. Die verbleibenden 40 Prozent des Gesamtenergiebedarfs müssen durch konventionelle Energiequellen bereitgestellt werden. Das kann in der Praxis bedeuten: In den Sommermonaten lässt sich der Warmwasserbedarf nahezu vollständig solar abdecken. In den Übergangszeiten wie Frühjahr und Herbst ist jedoch eine zusätzliche Heizleistung erforderlich. Im Winter, wenn der Wärmebedarf am höchsten ist, kann der Ertrag durch die Solarthermie nur einen vergleichsweise geringen Anteil decken. Der Deckungsgrad für eine Solarthermie sollte in der Regel stets zwischen 50 und 60 Prozent liegen.
Was ist ein realistischer Deckungsgrad für Deutschland bei Warmwasser/Heizung?
Bei einer optimalen Planung und guter Dämmung sind Einsparungen von bis zu 60 Prozent bei den Warmwasserkosten möglich. Mindestens können Sie 35 Prozent beim Warmwasser und zehn Prozent bei zusätzlicher Heizungsunterstützung einplanen.
Welche Tools oder Software gibt es zur Berechnung von Solarthermie?
- T*SOL (Valentin Software): professionelle Simulation mit Ertragsvorschau und Wirtschaftlichkeitsberechnung
- Polysun (Vela Solaris): leistungsstarkes Tool für komplexe Systemsimulationen
- ZUB Helena: geeignet für Architekten und Planer, inklusive BAFA-konformer Nachweise
- nPro-Tool: Solarrechner, simuliert Solarthermieanlagen
- herstellerspezifische Dachplaner: oft auf konkrete Produktlinien abgestimmt
Eine Simulation lohnt sich immer dann, wenn mehrere Parameter berücksichtigt werden müssen oder wenn Förderprogramme einen technischen Nachweis verlangen. Besonders bei Kombianlagen oder komplexen Gebäuden (z. B. mit mehreren Heizkreisen) ist eine Simulation dem Einsatz von Faustformeln deutlich überlegen. Sie liefert Tages-, Monats- und Jahreserträge, visualisiert Lastgänge und hilft bei der optimalen Systemkonfiguration. Für eine fundierte Auslegung von Solarthermieanlagen stehen einige Softwarelösungen zur Verfügung. Sie reichen von einfachen Solarrechnern für Hausbesitzer bis hin zu komplexen Simulationsprogrammen für Fachplaner.
Wann sollte ich einen Energieberater hinzuziehen?
- bei Kombianlagen mit Heizungsunterstützung
- bei komplexen Gebäudestrukturen, Sanierungen und Neubau
- bei Förderanträgen, die exakte Nachweise erfordern
- wenn Unsicherheiten bei der Systemintegration bestehen
Ein zertifizierter Energieberater analysiert den realen Energiebedarf, identifiziert Optimierungspotenziale und erstellt exakte Berechnungen. Somit erhalten Sie eine maßgeschneiderte Auslegung auf Basis Ihres Gebäudes und Nutzerverhaltens. Zudem ist er mit den aktuellen Förderkriterien vertraut und kennt die Fallstricke bei der Planung. Ein Energieberater kann für Förderprogramme oft eine Voraussetzung sein. Die BAFA bietet für eine Energieberatung zudem eine Förderung von bis zu 50 Prozent. Wichtig ist dabei, dass Sie mit einem zertifizierten Energieberater zusammenarbeiten.
Welche Normen und Richtlinien gelten bei der Auslegung?
| Norm | Inhalt / Fokus | Relevanz für die Auslegung |
|---|---|---|
| DIN EN ISO 9806 / EN 12975 | Kollektorprüfung und Leistungsangaben |
|
| DIN EN 12977 (Blatt 1–5) | Komponenten- und Systemprüfung kundenspezifischer Anlagen |
|
| DIN V 4701-10 | energetische Systembewertung |
|
| VDI 6002 Blatt 1 | Planung und Ausführung von Trinkwasseranlagen |
|
| Gebäudeenergiegesetz (GEG) | wichtige Vorgaben für die Planung Solaranlagen |
|
| Solarpflicht Deutschland | Verpflichtung von Unternehmen und Hauseigentümern bei Neubau oder bei Sanierungen, Solaranlagen zu installieren |
|
Welche Planungsfehler treten in der Praxis häufig auf?
Trotz steigender Erfahrung mit Solarthermieanlagen treten in der Praxis nach wie vor zahlreiche Fehler auf, die die Effizienz und Lebensdauer der Anlage massiv beeinträchtigen. Häufig sind diese Fehler auf mangelnde Planung, veraltete Annahmen oder fehlende Abstimmung mit bestehenden Heizsystemen zurückzuführen.
| Planungsfehler | Ursache | Folgen |
|---|---|---|
| falsch dimensionierte Kollektorfläche |
|
|
| unpassende Speichergröße |
|
|
| falsche Dachausrichtung oder ungeeigneter Neigungswinkel |
|
|
| fehlende oder unzureichende Rohrleitungsdämmung |
|
|
| kein hydraulischer Abgleich |
|
|
| ungeeignete Steuerung oder fehlende Nachheizlogik |
|
|
| Nichtbeachtung saisonaler Ertragsschwankungen |
|
|
| Auswahl ungeeigneter Kollektortechnik |
|
|
| Vernachlässigung der Gebäudeanalyse bei Sanierungen |
|
|
| zu später Förderantrag |
|
|
Checkliste: Diese Angaben brauchen Sie für eine sinnvolle Berechnung
| Angaben | Woher erhalten |
|---|---|
| Personenanzahl |
|
| Warmwasserbedarf pro Tag |
|
| beheizte Wohnfläche (bei Heizungsunterstützung) |
|
| Dachausrichtung (Süd, Ost, West) und Dachneigung |
|
| mögliche Verschattungen (z. B. durch Nachbargebäude oder Bäume) |
|
| Region/Postleitzahl (für Strahlungsdaten) |
|
| Art des bestehenden Heizsystems (Wärmepumpe, Fernwärme etc.) |
|
| bereits vorhandene Speicher (Volumen und Zustand) |
|
| Zielsetzung: Warmwasser allein oder Kombination mit Heizung? |
|
Normwerte oder Schätzungen können als Ausgangspunkt dienen. Doch je präziser die Angaben sind, desto besser lässt sich die Anlage auslegen, wirtschaftlich bewerten und technisch optimieren. Wer hier nur grob rechnet, riskiert Fehlauslegungen und vermeidbare Kosten. Auf eine sorgfältige Berechnung und die fundierte Einschätzung eines Profis sollten Sie daher nicht verzichten.
Diese 5 Dinge sollten Sie beachten
- Dimensionieren Sie Ihre Anlage niemals pauschal, sondern immer individuell auf Basis von Wärmebedarf, Standort, Dachausrichtung und Nutzung, denn nur so kann sie effizient und wirtschaftlich arbeiten.
- Berücksichtigen Sie die Speichergröße genauso sorgfältig wie die Kollektorfläche. Ein zu kleiner sowie ein zu großer Speicher verschlechtern den Wirkungsgrad Ihrer Anlage deutlich. Solaranlage und Speicher müssen optimal aufeinander abgestimmt sein.
- Wenden Sie sich frühzeitig an einen Profi, um Ihren genauen Energiebedarf zu ermitteln und Förderanträge fristgemäß zu beantragen.
- Nutzen Sie Solarrechner und professionelle Beratung besonders bei Kombianlagen, Förderanträgen oder komplexen Gebäuden. Auch wenn Sie alle relevanten Faktoren berücksichtigen und sorgfältig mit der Faustfromel rechnen, kann am Ende nur ein Profi ein verifizierte Einschätzung zu Ihrem Eigenbedarf und die dafür benötige Anlagengröße geben.
- Integrieren Sie die Solarthermie strategisch in Ihr Heizsystem. Wenn Sie dabei auf niedrige Vorlauftemperaturen, Speicher mit Schichtung und smarte Steuerung setzen, können Sie Ihre Energieausbeute maximieren.
Fazit
Eine Solarthermieanlage bietet ein enormes Potenzial zur Einsparung von Energie und Emissionen. Wichtig hierfür ist, dass Ihre Anlage richtig auf Ihren Eigenbedarf dimensioniert, fachgerecht installiert und bei Bedarf sinnvoll ins Heizsystem integriert ist. Während einfache Warmwasseranlagen schon mit wenigen Quadratmetern Fläche arbeiten, erfordern Kombisysteme zur Heizungsunterstützung eine deutlich differenzierte Planung. Nur mit einem Profi an Ihrer Seite können Sie eine exakte Solarplanung vornehmen und Ihre Anlage genau auf Ihre Bedürfnisse auslegen.
Solaranlage berechnen: Häufig gestellte Fragen
Wie unterscheidet sich die Solarthermie-Planung bei Altbau und Neubau?
Im Neubau kann die Solarthermie bereits in der Planungsphase optimal in das Heizkonzept integriert werden, zum Beispiel durch Kombination mit Flächenheizungen und effizienten Speichersystemen. Im Altbau hingegen ist oft die Heizstruktur weniger kompatibel mit solarer Niedertemperaturwärme, was zusätzliche Planung erfordert.
Wie lange hält eine Solarthermieanlage?
Sie können im Durchschnitt mit einer Lebensdauer zwischen 20 und 30 Jahren rechnen, je nach Qualität und Pflege. Der Solarspeicher sollte nach etwa fünf Jahren geprüft und bei Bedarf ersetzt werden. Regelmäßige Wartung, insbesondere der Pumpe und der Steuerung, verlängert die Nutzungsdauer Ihres Solarsystems erheblich.
Wie hoch ist der Wartungsaufwand einer Solarthermieanlage?
Einmal jährlich sollte die Funktionsfähigkeit überprüft werden, insbesondere Temperaturfühler, Regelung und Kollektoren. Alle fünf Jahre empfiehlt sich ein Check des Solarfluids und der Sicherheitsventile.
Welche Dachformen sind besonders gut geeignet für Solarthermie?
Satteldächer mit Südausrichtung und einer Neigung von 30 bis 60 Grad sind ideal. Aber auch Ost- oder Westdächer funktionieren gut mit erhöhter Kollektorfläche. Flachdächer erfordern Aufständerung, bieten aber eine höhere Flexibilität bei der Ausrichtung.
Kann ich Solarthermie mit Photovoltaik kombinieren?
Ja, das ist möglich und sinnvoll. Voraussetzung sind eine ausreichend Dachfläche und eine Planung, die gegenseitige Verschattung vermeidet. Beide Systeme ergänzen sich gut: Solarthermie für Wärme, Photovoltaik für Strom.